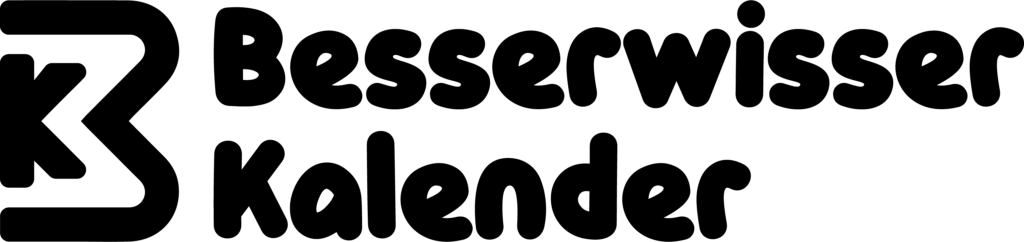Heute vor 62 Jahren, am 16. Februar 1962, erlebte Hamburg die schwerste Sturmflut seiner Geschichte. Eine gewaltige Flutwelle, angetrieben von einem Orkan, überflutete weite Teile der Stadt und forderte 315 Todesopfer. Die Katastrophe offenbarte gravierende Mängel im Hochwasserschutz und im Krisenmanagement
Die Sturmflut von 1962 war das Ergebnis einer unglücklichen Kombination von Faktoren: Ein Tiefdruckgebiet über der Nordsee, das starke Winde aus Nordwesten erzeugte, traf auf eine Springtide, die ohnehin hohe Wasserstände verursachte. Die Flutwelle, die sich dadurch bildete, erreichte in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar die deutsche Nordseeküste und drang in die Flussmündungen von Elbe und Weser ein. Die Deiche, die zum Teil noch aus dem 19. Jahrhundert stammten und nicht den modernen Anforderungen entsprachen, konnten dem Druck nicht standhalten und brachen an vielen Stellen. Besonders betroffen war das 100 Kilometer von der Küste entfernte Hamburg, wo vor allem die Stadtteile Neuenfelde, Wilhelmsburg und Finkenwerder überschwemmt wurden. Die Bewohner wurden im Schlaf von den Wassermassen überrascht und hatten kaum eine Chance zu fliehen. Viele ertranken in ihren Häusern oder wurden von Trümmern erschlagen. Die Rettungskräfte waren überfordert und schlecht koordiniert. Die Kommunikation war gestört, die Stromversorgung unterbrochen, die Straßen unpassierbar. Erst nach mehreren Tagen gelang es, die Lage unter Kontrolle zu bringen und die Überlebenden zu versorgen.
Ein Mann, der sich in der Sturmflut von 1962 besonders hervortat, war der damalige Hamburger Innensenator Helmut Schmidt. Er übernahm die Leitung des Krisenstabes und agierte umsichtig und beherzt. Er ordnete die Evakuierung der bedrohten Gebiete an, mobilisierte die Bundeswehr, die NATO und andere Hilfskräfte und koordinierte die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen. Er scheute sich nicht, die Zuständigkeiten der verschiedenen Behörden zu übergehen und eigenmächtig zu handeln, wenn es die Situation erforderte. Er informierte die Öffentlichkeit regelmäßig über den Stand der Dinge und gab den Menschen Mut und Hoffnung. Sein entschlossenes und souveränes Auftreten brachte ihm viel Anerkennung und Respekt ein, sowohl in Hamburg als auch im Rest der Bundesrepublik. Er begründete so seinen Ruf als Krisenmanager, der ihm später als Bundeskanzler zugutekommen sollte.
Die Sturmflut von 1962 war ein Weckruf für Hamburg und ganz Deutschland. Die Stadt erkannte, dass sie ihren Hochwasserschutz dringend verbessern musste, um sich vor zukünftigen Fluten zu schützen. In den folgenden Jahren wurden die Deiche erhöht, verstärkt und mit modernen Sicherheitssystemen ausgestattet. Zudem wurden Sperrwerke, Flutschutztore, Polder und andere Maßnahmen errichtet, um den Wasserstand zu regulieren und die gefährdeten Gebiete zu entlasten. Auch das Krisenmanagement wurde reformiert und professionalisiert. Die Behörden, die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk, das Rote Kreuz und andere Organisationen arbeiten heute eng zusammen, um im Falle einer Sturmflut schnell und effektiv zu handeln. Die Bevölkerung wird regelmäßig über die Gefahren und die Verhaltensregeln informiert und an Übungen beteiligt. Die Stadt verfügt über ein modernes Hochwasserportal, das aktuelle Daten und Warnungen bereitstellt.
Die Sturmflut von 1962 hat Hamburg nachhaltig geprägt. Die Stadt hat aus der Katastrophe gelernt und sich zu einer der sichersten und resilientesten Städte Europas entwickelt. Die Erinnerung an die Opfer und die Helfer der Sturmflut bleibt jedoch lebendig. An vielen Orten in der Stadt gibt es Gedenkstätten, Denkmäler, Museen und Dokumentationen, die an die Ereignisse von damals erinnern. Die Sturmflut von 1962 ist ein Teil der Hamburger Identität und ein Mahnmal für den Respekt vor der Natur.
 Bild: Public Domain | Public Domain
Bild: Public Domain | Public DomainBildquellen auf dieser Seite:
- Sturmflut-981px-Watersnood_in_Hamburg_Bestanddeelnr_913-5394-Public-Domain: Public Domain | Public Domain
- Heath-Ledger-shutterstock_93494641-crop: Shutterstock | Shutterstock