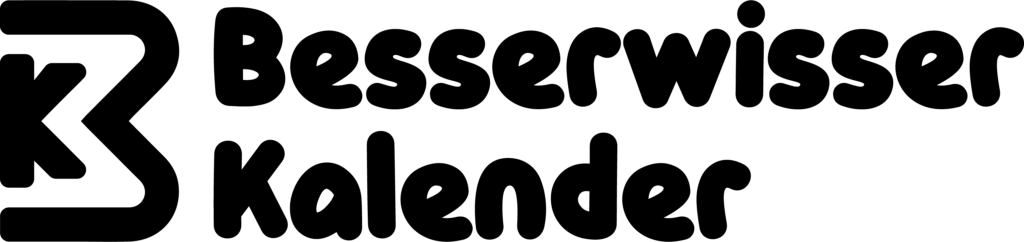Am 31. März 1953 unterzeichneten 17 Staaten in New York eine Resolution der Vereinten Nationen, die die Gleichberechtigung von Männern und Frauen forderte – ein bahnbrechendes Dokument in einer Zeit, in der Frauen in vielen Teilen der Welt weder über die gleichen Rechte verfügten noch die gleichen Chancen im gesellschaftlichen, beruflichen oder politischen Leben hatten.
Die Resolution war Ausdruck eines Wandels, der nach dem Zweiten Weltkrieg langsam in Gang kam. Frauen hatten in Kriegszeiten Verantwortung übernommen, Arbeitsplätze besetzt und Führungsrollen übernommen. Doch nach Kriegsende wurden viele wieder in traditionelle Rollen zurückgedrängt. Die UNO-Resolution von 1953 setzte hier ein klares Zeichen: Gleichberechtigung ist ein Menschenrecht.
Seit 1953 haben sich nahezu alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zur Gleichberechtigung bekannt – zumindest auf dem Papier. Inzwischen haben mehr als 190 Länder entsprechende Erklärungen unterzeichnet oder in ihre Verfassungen aufgenommen. Doch der Weg von der Unterschrift zur gelebten Realität ist oft lang und steinig.
Einige Staaten, insbesondere mit stark patriarchalischen oder religiös konservativen Gesellschaftsstrukturen, haben sich der ursprünglichen Resolution bis heute nicht angeschlossen oder sich bei späteren Umsetzungsdokumenten enthalten. Dazu gehören unter anderem der Vatikan (Staat der Vatikanstadt), der als Beobachterstaat agiert und keine völkerrechtlich bindenden UN-Dokumente ratifiziert, sowie einige Staaten mit instabilen politischen Systemen oder fundamentalistischen Herrschaftsformen, wie Afghanistan unter der aktuellen Taliban-Herrschaft. Auch Saudi-Arabien hat zwar mittlerweile zahlreiche Reformen eingeleitet, bleibt aber bei bestimmten Gleichstellungsfragen hinter den UN-Standards zurück.
Auch in Deutschland war die Gleichberechtigung 1953 noch keine Selbstverständlichkeit. Zwar wurde mit dem Grundgesetz von 1949 die Gleichheit von Männern und Frauen (Artikel 3, Absatz 2) festgeschrieben, doch in der Praxis hinkte die gesellschaftliche Entwicklung hinterher. Noch bis 1977 durften verheiratete Frauen in der Bundesrepublik Deutschland nur mit Zustimmung ihres Ehemanns berufstätig sein. Erst ab 1977 wurde das sogenannte „Leitbild der Hausfrauenehe“ endgültig abgeschafft.
In der DDR war die rechtliche Gleichstellung der Geschlechter früher und formell weiter fortgeschritten, allerdings blieb auch dort die tatsächliche Gleichverteilung von Machtpositionen und gesellschaftlicher Verantwortung eingeschränkt.
Heute steht Deutschland im internationalen Vergleich gut da: Der Zugang von Frauen zu Bildung und Beruf ist gesichert, rechtliche Regelungen wie das Elterngeld oder der Schutz vor Diskriminierung haben für mehr Chancengleichheit gesorgt. Dennoch gibt es weiterhin strukturelle Unterschiede. Frauen sind seltener in Führungspositionen und häufiger von Altersarmut betroffen. Das liegt aber nicht an fehlenden Rechten, sondern daran, dass Männer und Frauen oft unterschiedliche Lebensformen gewählt haben. Um dem per Zwang entgegenzuwirken, wurden in den letzten Jahren sogenannte Frauenquoten eingeführt, etwa für Aufsichtsräte großer Unternehmen. Diese Quoten stehen jedoch massiv in der Kritik, da sie nicht auf dem Prinzip der Gleichberechtigung beruhen, sondern auf Gleichstellung abzielen – also auf eine gezielte Bevorzugung von Frauen, unabhängig von individueller Qualifikation. Kritiker sehen darin eine Abkehr vom Gleichheitsgrundsatz, der allen Menschen unabhängig vom Geschlecht die gleichen Rechte einräumt. Besonders in politischen Parteien wie „Bündnis 90/Die Grünen“ wird deutlich, dass Frauen systematisch bevorzugt werden, was das Spannungsverhältnis zwischen Gleichberechtigung und Gleichstellung verdeutlicht. Auch der Vorwurf, Gleichstellung bedeute „Geschlecht vor Qualifikation“ sollte ergebnisoffen diskutiert werden.
Die Resolution von 1953 war ein entscheidender Impuls für die internationale Gleichberechtigungspolitik. Seitdem hat sich viel getan – gesetzlich, gesellschaftlich und kulturell. Doch Gleichberechtigung ist kein Zustand, der einmal erreicht und dann abgeschlossen ist. Sie ist ein dauerhafter Prozess, der Aufmerksamkeit, Engagement und mutige politische Entscheidungen erfordert.
Auch über 70 Jahre später bleibt die Botschaft der Resolution aktuell: Gleiche Rechte, gleiche Chancen – für Männer und Frauen, weltweit.
 Bild: Werner Niedermeier | Werner Niedermeier
Bild: Werner Niedermeier | Werner NiedermeierBildquellen auf dieser Seite:
- Gleichberechtigung von Mann und Frau bei der UNO unterzeichnet KI wn: Werner Niedermeier | Werner Niedermeier
- Ältere Menschen Mann Frau KI wn: Werner Niedermeier | Werner Niedermeier
- Casanova_ritratto-Gemeinfrei: Public Domain | Public Domain