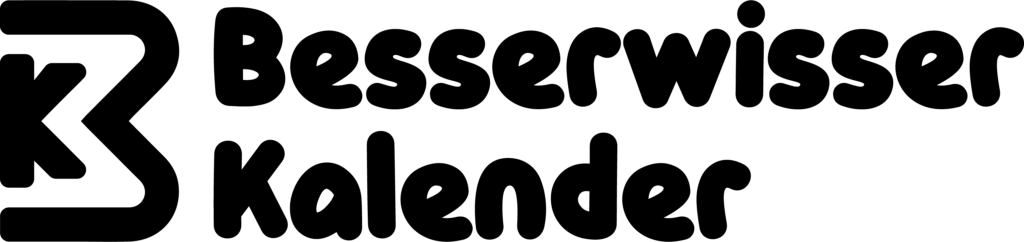Am 24. Februar 1971 fällte das Bundesverfassungsgericht eine Grundsatzentscheidung zu den Themen Kunstfreiheit und zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht, die bis heute Relevanz hat. Es ging um den Roman “Mephisto” von Klaus Mann, der den Aufstieg des Schauspielers Hendrik Höfgen im Dritten Reich schildert. Die Romanfigur basierte erkennbar auf dem realen Schauspieler Gustaf Gründgens, der unter den Nationalsozialisten Karriere machte und nach dem Krieg zum Intendanten des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg ernannt wurde.
Der Adoptivsohn und Erbe von Gründgens, Peter Gorski, klagte gegen die Veröffentlichung des Romans in Deutschland, da er ihn als eine ehrverletzende Schmähschrift ansah, die das Andenken seines Vaters beschmutze. Die Zivilgerichte gaben ihm Recht und verboten die Vervielfältigung, den Vertrieb und die Veröffentlichung des Buches. Der Verlag, der den Roman herausgeben wollte, legte Verfassungsbeschwerde ein und berief sich auf die Kunstfreiheit nach Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes.
Das Bundesverfassungsgericht wies die Beschwerde zurück und bestätigte das Verbot des Romans. Es definierte erstmals den Begriff der Kunst aus verfassungsrechtlicher Sicht und stellte klar, dass auch die Kunstfreiheit verfassungsimmanenten Schranken unterliegt, die sich aus anderen Grundrechten ergeben, insbesondere aus der Menschenwürde und dem Persönlichkeitsrecht. Das Gericht nahm eine Abwägung zwischen der Kunstfreiheit und dem Persönlichkeitsrecht vor und kam zu dem Ergebnis, dass in diesem Fall das Persönlichkeitsrecht von Gründgens schwerwiegender verletzt sei als die Kunstfreiheit von Mann. Das Gericht betonte, dass der Roman nicht nur eine künstlerische Gestaltung, sondern auch eine politische Aussage enthalte, die den Ruf von Gründgens nachhaltig schädige.
Die Mephisto-Entscheidung löste eine heftige Debatte in der Öffentlichkeit aus. Viele Kritiker sahen in dem Urteil eine Einschränkung der Kunstfreiheit und eine Bevormundung der Leser. Sie warfen dem Gericht vor, die historische Rolle von Gründgens zu verharmlosen und die künstlerische Qualität von Mann zu verkennen. Andere Befürworter lobten das Urteil als einen Schutz des Persönlichkeitsrechts und der Menschenwürde. Sie argumentierten, dass der Roman eine unzulässige Verfälschung der Lebensgeschichte von Gründgens sei und seine künstlerischen Leistungen ignoriere.
Die Mephisto-Entscheidung hat die Rechtsprechung und die Rechtswissenschaft in Deutschland nachhaltig geprägt. Sie gilt als ein wichtiger Bezugspunkt für die Auslegung und Anwendung der Kunstfreiheit und des Persönlichkeitsrechts. Sie hat auch die Literatur und die Kunst beeinflusst, die sich mit dem Thema der Anpassung und des Widerstands im Nationalsozialismus auseinandergesetzt haben. Der Roman “Mephisto” wurde zu einem Symbol für die kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und für die Verteidigung der Kunstfreiheit.
Wie sind ähnliche Sachverhalte in anderen Ländern geregelt? Es gibt kein einheitliches Vorgehen, wie die Kunstfreiheit und das Persönlichkeitsrecht in einem Konfliktfall abgewogen werden. Die Rechtsordnungen der verschiedenen Länder haben unterschiedliche Schwerpunkte und Kriterien, die von der jeweiligen Verfassung, der Rechtstradition, der Kultur und der Geschichte abhängen. Einige Beispiele sind:
- In den USA hat die Kunstfreiheit einen hohen Stellenwert und wird durch den ersten Zusatzartikel zur Verfassung geschützt, der die Meinungsfreiheit garantiert. Das Persönlichkeitsrecht wird durch das Zivilrecht geregelt, das Schadensersatzansprüche bei Verletzung der Privatsphäre oder des guten Rufs vorsieht. Die Kunstfreiheit wird jedoch in der Regel nicht durch das Persönlichkeitsrecht eingeschränkt, es sei denn, es liegt eine absichtliche Falschdarstellung oder eine böswillige Verleumdung vor. Ein bekannter Fall ist der Roman “Primary Colors” von Joe Klein, der die Präsidentschaftskampagne von Bill Clinton satirisch darstellt. Der Roman wurde nicht verboten, obwohl er erkennbar reale Personen porträtiert.
- In Frankreich hat die Kunstfreiheit ebenfalls einen hohen Stellenwert und wird durch die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 geschützt, die die freie Kommunikation der Gedanken und Meinungen gewährleistet. Das Persönlichkeitsrecht wird durch das Zivilrecht geregelt, das Schadensersatzansprüche bei Verletzung der Privatsphäre, der Ehre oder der Würde vorsieht. Die Kunstfreiheit wird jedoch in der Regel nicht durch das Persönlichkeitsrecht eingeschränkt, es sei denn, es liegt eine schwere Verletzung oder eine unverhältnismäßige Beeinträchtigung vor. Ein bekannter Fall ist der Roman “L’Amant” von Marguerite Duras, der die Liebesbeziehung der Autorin zu einem älteren Chinesen in Indochina schildert. Der Roman wurde nicht verboten, obwohl er erkennbar reale Personen porträtiert.
- In Großbritannien hat die Kunstfreiheit einen geringeren Stellenwert und wird durch das Menschenrechtsgesetz von 1998 geschützt, das die Europäische Menschenrechtskonvention in nationales Recht umsetzt. Das Persönlichkeitsrecht wird durch das Zivilrecht geregelt, das Schadensersatzansprüche bei Verletzung der Privatsphäre oder des guten Rufs vorsieht. Die Kunstfreiheit wird jedoch häufig durch das Persönlichkeitsrecht eingeschränkt, insbesondere durch das strenge Recht der üblen Nachrede, das den Kläger begünstigt.

Bildquellen auf dieser Seite:
- Steve Jobs shutterstock_2005719224 crop: Shutterstock | Shutterstock
- Twin Peaks Werbeplakat shutterstock_240942697 crop: Shutterstock | Shutterstock